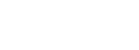Die geschichte des gregorianischen Chorals
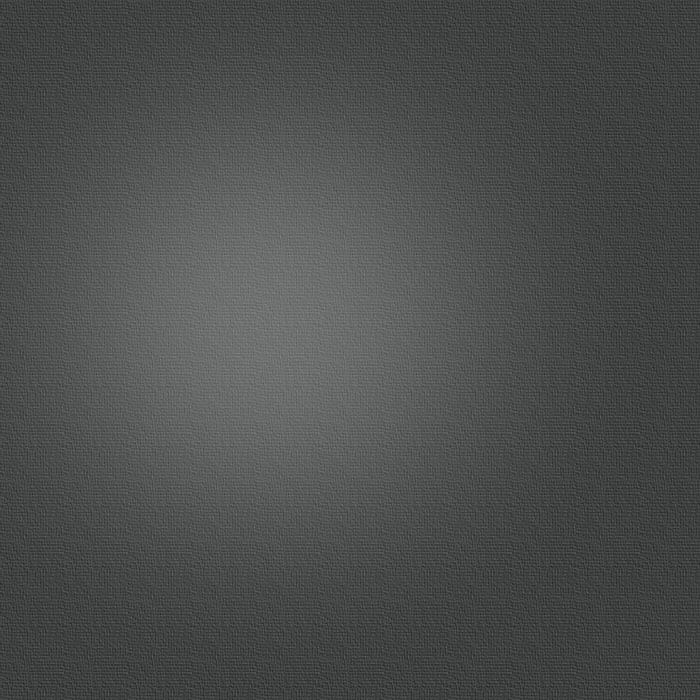
Der Anfang der Musik des Christentums ist wohl auf den Zeitpunkt des Letzten Abendmahls von Jesus Christus mit seinen Jüngern zurückzuführen. Dieses Passahmahl endete mit dem Gesang des Hallel (Psalmen 113 - 118, insgesamt gehören zu den Psalmen 150 Stück, die im Psalter des Alten Testaments zu finden sind). Daraus entstanden die Psalmgesänge des frühen Christentums.
Die Musik dieser Urchristen basierte zunächst auf Gesangsweisen der jüdischen Synagogengesänge. Hier wurden Gebetstexte von einem Lektor auf einem bestimmten Ton rezitiert, was als Kantillation bezeichnet werden könnte. Die Christen versammelten sich zum Gebet und Gesang, oft sogar vor Sonnenaufgang, wie Plinius berichtete.
Der nächste Schritt in der Entwicklung der Gesangsformen war wohl die Form des Wechselgesangs, bei dem ein Vorsänger Psalmen vortrug, woraufhin die Gemeinde mit kurzen Phrasen wie Alleluja, Kyrie eleison o.ä. antwortete.
Für die Entwicklung des gregorinaischen Gesangs sind auch die unterschiedlichen Einflüsse der unterschiedlichen Liturgieformen verantwortlich. Am meisten hat der gregorianische Gesang aber den Einfluss der römischen Messliturgie erfahren. In dieser Liturgie ergeben sich Gesänge, die in das Proprium und das Ordinarium eingeteilt werden.
Proprium:
Introitus, Graduale, Alleluia/Tractus, Offertorium, Communio
Ordinarium:
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Ite missa est
Aus dieser Liturgie heraus entwickelte sich der altrömische Gesang. Dieser Gesang ist wesentlich melismatischer (viele Noten auf wenig Text) als der sich später daraus entwickelnde neurömische Gesang.
Papst Gregor der Große (540-604 - Amtszeit 590-604) sammelte die Melodien des Officiums und der Messe dieser römischen Liturgie. Diese Zeit war auch der Höhepunkt dieser Musikrichtung, deshalb nannte man zu Ehren von Papst Gregor diese Musikrichtung gregorianischer Gesang bzw. Choral.
Der gregorianische Gesang wurde zunächst nur mündlich überliefert. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts entwickelte man eine Möglichkeit, Noten schriftlich in der sog. Neumenschrift darzustellen. Sie geht aus den cheironomischen Handzeichen hervor. Die Neumenschrift sollte zu diesem Zeitpunkt als Gedächtnisstütze dienen, setzte aber die Kenntnis der Neumen (griech. Wink, Gebärde) voraus. Diese Neumen gaben aber noch keine Tonhöhen an, sondern nur die Richtung, in die man sich stimmlich bewegen sollte. Um 1000 herum entwickelte sich dann aber ein System, das die Noten auf Linien darstellte, die im Terzabstand zueinander standen. Diese Notationsmöglichkeit verdanken wir Guido von Arezzo (992-1050). Aus diesem Notensystem entstand im 12. Jahrhundert die sog. deutsche Hufnagelschrift und die Quadratnotation, die in ihrer spätmittelalterlichen Ausprägung für die Notation des gregorianischen Gesangs bis heute erhalten blieb.